Schlagwörter
Wolfgang Sofsky
Johan Huizinga über Frans Hals – oder über die visuelle Oberflächlichkeit der Kunst
In seiner „Holländische Kultur im 17. Jahrhundert“ charakterisiert der große holländische Kulturhistoriker Johan Huizinga die Portraitkunst seines Landsmanns Frans Hals. Man muß dabei bedenken, daß Holland seinerzeit das europäische Bilderland war. Nirgends, auch in Italien nicht, waren Bilder in den Häusern des Alltags derart verbreitet. Um die Mitte des Jahrhunderts, also 1650, arbeiteten ca. 750 Malermeister im Land, die pro Jahr etwa 63.000 bis 70.000 Bilder anfertigten, also im Zeitraum von 1640 und 1660 etwa 1,3 Millionen Bilder. Der Wert dieser Bilderflut soll mehr als die Hälfte des Wertes der nordholländischen Käseproduktion betragen haben. Die Gemälde hingen überall. Gewiß waren die Bilder von wechselnder handwerklicher Qualität, aber das Ziel der Kunst war weder die moralische Botschaft noch irgendeine symbolische Bedeutung, sondern die präzise Darstellung von Dingen, Szenen und Personen. Alle akademischen Rätselspiele um den symbolischen Gehalt sind bei dieser visuellen Kultur völlig Fehl am Platze. Nur wer den Geist der Künstler mit dem Geist philosophisch gebildeter Kunsthistoriker verwechselt, kommt überhaupt auf die Idee, in den Bildern der Kunstgeschichte stets eine ikonologische Bedeutung ermitteln zu wollen. Huizinga, der den Begriff des Barock ablehnte, hat hier womöglich mehr über die barocke Kunst der Oberfläche erfaßt, als manch anderer Interpret. Bei Frans Hals jedenfalls ging es ziemlich schlicht zu:

„Wer bei der Betrachtung unsrer Malerei im siebzehnten Jahrhundert vom Einfachen zum Komplizierten fortschreiten will, muß von Frans Hals sprechen, bevor er von Rembrandt spricht, was übrigens schon das Handbüchlein der Lebensdaten nahelegt. Bei Frans Hals ist alles spontan, nichts überlegt und absichtlich, nichts gelehrt oder gesucht. Wer Frans Hals vor den Pinsel kam, durfte sein hübschestes Kleid anziehen und seine teuerste Halskrause umlegen, aber seine Eitelkeit mußte er besser zu Hause lassen. Selbst der Junker von Heythuysen kam nicht besser weg, als er es verdiente. Hals gab sich keine Mühe, diesen biederen runden Bürgern die Allüren eines Helden oder eines Edelmanns zu geben. Mit den von Hals Dargestellten verbinden wir gern die Vorstellung eines kräftigen und gesunden Äußeren. Sieht man genauer zu, so gibt es bei ihm auch allerlei kränkliche Figuren und auch zerfallene Typen. Außer dem Gesicht ist alles Eleganz, Schwung, ungezwungene Haltung. Es bleibt eines der Wunder der Kunst, wie der beinah achtzigjährige Frans Hals den Regentinnen des Altmännerhauses von Haarlem, diesen alten kleinen Damen mit ihren verlebten alltäglichen Gesichtchen, ein Leben von Jahrhunderten zu schenken vermocht hat, mit dem sie, auch wenn wir vielleicht nicht einmal ihren Namen und nichts von ihrem Tun und Lassen wissen, ebenso fest und so allbekannt in der Historie stehen wie ein Fürst oder ein Dichter. Man spreche uns nicht von Psychologie. Man sage doch nicht, daß der Maler ihre Seele ergründet habe: er dachte nicht daran. Aber seine Vision und seine Hand waren mächtiger, als er selbst es je gewußt hat oder hat wissen können, und er schuf hier ein Poem, aus dem eine ganze geschichtliche Periode und ein ganzes Volk sprach.“
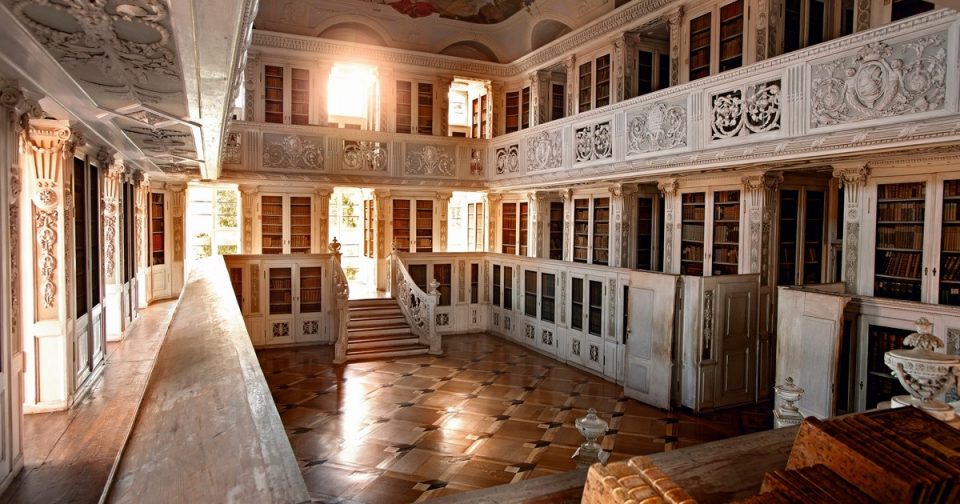
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.