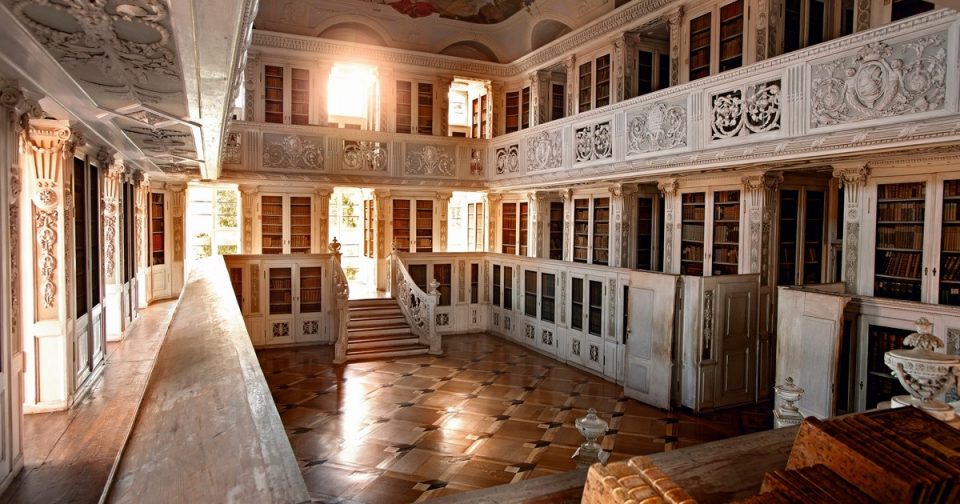Wolfgang Sofsky
Werktreue
Bei Aufführungen von Musikstücken, Opern oder Dramen stellt sich gelegentlich die Frage, ob das, was jeweils zur Darstellung auf die Bühne gelangt, ein und dasselbe ist wie das, was der Kompositeur oder Autor geschrieben hat. So wird auf dem Programmzettel angekündigt, es würde Shakespeares „Hamlet“, Goethes „Faust“, Mozarts „Don Giovanni“ oder Brechts „Baal“ gegeben. Doch in Wirklichkeit bekommt der erwartungsfrohe Besucher ein merkwürdiges Machwerk geboten. Verse oder Arien wurden großzügig gestrichen, Szenenfolgen willkürlich umgestellt, originale Regieanweisungen konsequent ignoriert und die Leerstellen, die sich durch die Streichungen ergaben, durch allerlei andere Texte aus fremder Feder aufgefüllt, im fatalsten Falle gar aus der Feder des Regisseurs oder Dramaturgen höchstselbst. Begründet wird derlei häufig mit der notwendigen Aktualisierung des alten Stücks, dem unbedingt notwendigen Realitätsbezug, dem noch notwendigeren Auftrag, das verstockte Publikum aufzurütteln und zu erziehen oder gar damit, der Urheber selbst habe ja seinerzeit auch ständig fremde Texte verwendet und an seinen Stücken fortlaufend herumgeschrieben.
Erbost sind die Machwerker regelmäßig, wenn das „reaktionäre“ Publikum das Original der Bearbeitung vorzieht, sich nicht provozieren läßt, sondern wegbleibt. Noch verärgerter ist man, wenn die Hüter der Urheberrechte, wie in einem jüngsten Fall, eine Inszenierung verbieten lassen, weil, wie es heißt, die Bearbeitung sich zu Unrecht mit dem Titel des Stücks zu schmücken unternimmt. Sofort sehen die Machwerker und ihre Apologeten die Freiheit der Kunst bedroht, obwohl sie nur die Freiheit zu ihrem Machwerk meinen. Sie ahnen zu Recht, daß nicht jeder Besucher inszenierte Skandale schätzt und an Bearbeitungen durch selbsternannte Machwerker, die lediglich auf Fragmente und Motive eines prominenten und allseits geschätzten Originals zurückgreifen, wenig Interesse zeigt. Man wollte Shakespeare sehen und nicht Müller, Mozart und nicht Meier. Man fragt sich, worüber man sich mehr wundern soll: über die Selbsterhebung der Machwerker und ihrer Fürsprecher oder über die Qualität der alten Stücke, die oft noch die dümmlichste Bearbeitung überstehen?
Große Kunstwerke eröffnen erhebliche Spielräume der Deutung und des Verständnisses. Sie verlangen detaillierte, monate- oft jahrelange Lektüre, Note für Note, Wort für Wort, Komma für Komma, sie fordern vom Interpreten intellektuelle Klugheit, wenn nicht Weisheit, Entdeckerfreude, unzählige Proben und ab und zu eine Idee, die sich bei gründlicher Analyse meist von selbst ergibt. Originalität ist zweitrangig. Der Verdacht, das alte Werk sei langweilig, ist meist nur eine Projektion des Rezipienten von sich auf den Text. Große Texte und Werke sind, so sagt man, oft klüger als ihr Autor; Interpreten oder Kritiker indes wissen selten mehr der Autor.
Doch wie immer eine Interpretation ausfallen mag, es gibt Identitätskriterien für die Darstellung/Aufführung eines Kunstwerks: den Text der Noten oder Worte. Das gilt für Sonaten, Komödien, Tragödien, Gesamkunstwerke gleichermaßen. Ein Pianist, der in der Arietta von Beethovens op.111 eine weitere Variation hinzufügt, weil er die vorliegenden für unzureichend, langweilig, nicht aktuell genug hält, stieße zu Recht auf Unverständnis. Man müßte ihm entgegenhalten, er habe nicht nur Fehler gemacht, sondern ein Machwerk dargeboten. Ein Pianist, dem beim Vortrag mehrere falsche Noten unterlaufen, von dem würde man sagen, er habe zwar versucht, op.111 aufzuführen, aber er habe hierbei einige, vielleicht verzeihliche Fehler, gemacht, die mit etwas Übung womöglich zu vermeiden wären. Ein Pianist, der die vorgesehene Wiederholung der Exposition wegließe, sonst aber alle Noten zu Gehör brachte, dem würde man eine unvollständige Darbietung bescheinigen. Ein Pianist schließlich, der statt der Noten von op.111 ein Sammelsurium von anderen Beethoven-Sätzen oder gar eigene Kompositionen zum Besten gäbe, dem würde man gezielten Etikettenschwindel zuschreiben. Es gibt mithin fehlerhafte, mangelhafte, unvollständige Aufführungen, es gibt Bearbeitungen und es gibt Etikettenschwindel. Nicht wenige Zeitgenossen sind der nicht unbegründeten Meinung, daß auf manchen Bühnen der Schwindel mittlerweile die Regel ist.
© W.Sofsky 2015